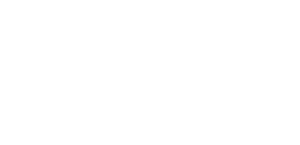Die Diagnose einer erblich bedingten Netzhauterkrankung ist ein Schock. Wie Betroffene mit dem fortschreitenden Sehverlust klarkommen und wem die neue Gentherapie nützt.
Von Felicitas Witte
Wenn Stephan Hüsler, Vater von drei Kindern, abends heimkam, gab es «Papi-Alarm»: alle Kinder und die Spielzeuge aus dem Weg! «Ich wäre sonst über die Kinder gestolpert und hätte das eine oder andere Spielzeug zertreten», so erinnert sich der heute 62-Jährige.
Mit Mitte 20 merkte er, dass er nicht mehr so gut sehen konnte, vor allem im Dunkeln und vor allem das, was am Rande seines Gesichtsfeldes geschah. Mit 30 musste er das Velofahren aufgeben, Auto fahren durfte er nie. Immer wieder lief er in Menschen hinein, stiess sich an Pfeilern, Pfosten oder Tafeln und verletzte sich. Sein Augenarzt sprach von Pigmentverschiebungen in der Netzhaut.
«Ich habe das aber verdrängt und mit Kurzsichtigkeit und Hornhautverkrümmung erklärt», sagt Hüsler. Die Diagnose bekam er eine Woche vor seinem 40. Geburtstag: eine erbliche Netzhauterkrankung, die voranschreitet und mit zunehmendem Sehverlust einhergeht. «Ich war einerseits erleichtert, weil ich endlich wusste, warum ich so schlecht sah», sagt Hüsler. Andererseits habe er dann langsam realisiert, was das bedeutet. «Der Gedanke an meine Frau und unsere drei kleinen Kinder hielt mich am Leben.»
Mutationen in über 280 Genen
Erblich bedingte Netzhauterkrankungen oder Netzhautdystrophien sind eine Gruppe von Krankheiten, die durch Mutationen – also Veränderungen – in jeweils einem bestimmten Gen entstehen. Inzwischen wurden Zehntausende von Mutationen in mehr als 280 Genen identifiziert. Durch die Mutationen werden bestimmte Signalwege gestört, was letztlich dazu führt, dass die Sinneszellen in der Netzhaut nach und nach sterben.
Im Unterschied zu anderen Netzhauterkrankungen – beispielsweise solchen, die durch langjährigen Diabetes bedingt sind – treten die ersten Symptome häufig im Kindes- oder jungen Erwachsenenalter auf. «Das macht die Krankheiten noch schlimmer, denn die Betroffenen haben ihr ganzes Leben vor sich», sagt Hendrik Scholl, Direktor der Augenklinikam Universitätsspital Basel (bis 2024 – Anmerk. von Retina Suisse). «Es gibt aber auch Patienten, die 60 oder 70 Jahre alt werden und kaum im Sehen eingeschränkt sind.»
Am häufigsten werden die Krankheiten autosomal-rezessiv vererbt. Es braucht also ein krankes Gen von der Mutter und eines vom Vater, damit die Krankheit ausbricht. Manche Netzhauterkrankungen betreffen in erster Linie die Stäbchensinneszellen, mit denen wir Hell und Dunkel wahrnehmen.
Diese Formen heissen Retinitis pigmentosa. Typischerweise merken die Betroffenen zuerst, dass sie im Dunkeln nicht mehr gut sehen können. Später engt sich ihr Gesichtsfeld immer mehr ein, bis sie nur noch wie durch einen Tunnel sehen. In anderen Fällen sterben zunächst die Zapfensinneszellen, die für die hohe Sehschärfe und das Farbensehen verantwortlich sind. Oder es sind beide Zellformen betroffen wie im Falle der Leberschen kongenitalen Amaurose.
Der Sehverlust fängt schon in den ersten Lebensmonaten an. Babys fixieren nicht gut mit ihrem Blick, die Augen zittern, und der Pupillenreflex lässt sich nicht auslösen. Manche Erkrankungen sind auf den Bereich des schärfsten Sehens beschränkt, die Makula. Betroffene sehen immer unschärfer, völlig blind werden sie meist aber nicht.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Diagnostik so verbessert, dass sich die Krankheiten zuordnen lassen und der Verlauf sicherer vorhergesagt werden kann. Natürlich sei die Diagnose erst einmal ein Schock, sagt Scholl. «Ich versuche zu erklären, dass es vielleicht nicht ganz so furchtbar ist, wie es im ersten Augenblick erscheint, und es nicht bedeutet, dass plötzlich das Licht ausgeht.» Er sei immer wieder überrascht, dass viele seiner Patienten ein ziemlich normales Leben führten und manche beruflich Karriere machten.
Menschen aus der ganzen Schweiz beraten
Stephan Hüsler musste nach 23 Jahren schweren Herzens seinen Job am Bankschalter aufgeben. «Ich sah meine Kunden nicht mehr, lief in Kollegen oder Büromöbel hinein und konnte Kundenunterschriften nicht mehr prüfen – das war natürlich ein Sicherheitsrisiko.» Er studierte soziale Arbeit und wurde Geschäftsleiter von Retina Suisse. Sein Job sei nun viel interessanter als früher, sagt er. «Ich berate Menschen aus der ganzen Schweiz in ihrer Muttersprache, unterstütze Betroffene, spreche mit führenden Augenärzten über neueste Entwicklungen, nehme an Ärztekongressen teil und organisiere Tagungen. All das wäre am Bankschalter nie möglich gewesen.»
Nur für eine Unterform der Leberschen kongenitalen Amaurose, nämlich die mit Mutation im RPE65-Gen, ist seit 2020 eine Gentherapie zugelassen. Die anderen Netzhauterkrankungen lassen sich bisher nicht heilen. Bei der Gentherapie werden gesunde Versionen des RPE65-Gens in leeren Viren – wie in Taxis – transportiert und im Rahmen einer Operation unter die Netzhaut gespritzt. Die Virentaxis laden die Gene unter der Netzhaut ab, wo dann das fehlende RPE65 hergestellt wird.
In einer einschlägigen Studie mit 11 Erwachsenen und 20 Kindern schnitten die behandelten Teilnehmer in einem vordefinierten Parcours-Test, den sie unter schlechten Lichtverhältnissen und mit eingebauten Hindernissen und Stufen gehen mussten, besser ab. Allerdings wurde nach der Zulassung bei manchen Patienten beobachtet, dass deren Netzhaut an einzelnen Stellen zugrunde ging.
«Immerhin blieb der Effekt durch die Gentherapie erhalten», sagt Scholl. Man müsse das weiter untersuchen. «Eine definitive Aussage über den langfristigen Nutzen der Gentherapie können wir erst in einigen Jahren machen.»
Bestätigung durch Gentest
Retina Suisse und Augenärzte empfehlen, die Diagnose von Netzhauterkrankungen durch einen Gentest bestätigen zu lassen. «Bis auf die RPE65-Genmutation ergibt sich daraus zwar keine therapeutische Konsequenz», sagt Nicole Eter, Direktorin der Augenklinik in der Uniklinik Münster. «Aber zum einen können die Patienten je nach Mutation an Studien teilnehmen, zum anderen ist das wichtig für die Familienplanung.»
Er sei froh gewesen, erzählt Stephan Hüsler, als er das Ergebnis seines Gentests erfahren habe: Sein defektes Gen wird so vererbt, dass seine Kinder nicht erkranken werden. Jeder Patient hat jedoch das Recht, keinen Gentest machen zu lassen. Nicht versäumen solle man aber die jährlichen Kontrollen, sagt Eter. «Das ist nicht nur wichtig, um zu wissen, ob man noch Auto fahren sollte, sondern auch, um behandelbare Komplikationen zu erkennen.»
Typisch sind Linsentrübungen oder Flüssigkeitsansammlungen an der Stelle des schärfsten Sehens, was mit einer künstlichen Linse beziehungsweise mit Medikamenten therapiert wird.
Getestet werden diverse neue Therapien. Das sind zum Beispiel Gentherapien für andere Mutationen als bei RPE65, die «Genomchirurgie», bei der das kranke Gen herausgeschnitten und durch ein gesundes ersetzt wird, solche mit Stammzellen, die eine neue Netzhaut herstellen, oder die optogenetische Therapie. Hier werden lichtempfindliche Proteine in Netzhautzellen gebracht, die auf Lichtreize reagieren und die Signale an das Hirn weiterleiten sollen. Netzhautimplantate, die Bilder der Umgebung in elektrische Impulse umwandeln, hielten dagegen nicht das, was sie versprachen.
«Welche Ansätze sich durchsetzen, werden wir erst in einigen Jahren wissen», sagt Scholl. «Und womöglich werden wir mithilfe von künstlicher Intelligenz mehr Möglichkeiten haben.» So gibt es bereits erste erfolgreiche Versuche, blinde Menschen mithilfe von Handy und künstlicher Intelligenz durch einen Universitätscampus, Hotels oder Einkaufszentren zu leiten.
Erschienen in der NZZ am Sonntag, 5.11.2023, S.11 (Beilage Gesundheit)
PDF-Version des Artikels in der NZZ am Sonntag via Medienübersicht von Retina Suisse