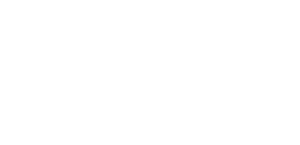Riguardo ai test genetici per ipovedenti, ci si chiede fino a che punto può spingersi il diritto di non sapere se ciò complica la diagnosi o la terapia? Che cosa emerge da un tale test? E che ne è del diritto di avere figli? Queste e altre domande sono state oggetto di una vivace discussione durante la 44a Assemblea generale.
Autore: Peter Jankovsky, responsabile della comunicazione di Retina Suisse
Un dibattito pubblico ha concluso in maniera entusiasmante la 44a Assemblea generale di Retina Suisse. L’oftalmologo Prof. Dr. Hendrik Scholl (Ospedale Universitario di Basilea) e l’oftalmogenetista Prof. Dr. Pascal Escher (Inselspital di Berna) hanno dato vita a un vivace scambio di opinioni tra gli 85 membri presenti. Il moderatore era Stephan Hüsler, il direttore di Retina Suisse.
La domanda chiave all’inizio della discussione con il pubblico è stata: Dovrei, in quanto ipovedente, sottopormi a un test genetico per far sì che sia garantita una migliore cura della mia malattia oculare? Questa domanda riguarda il diritto di sapere il più possibile sulla propria malattia – o di non volerne deliberatamente saper niente, infatti anche il non sapere è una scelta legittima.
Finché si tratta solo di se stessi, entrambe le possibilità vanno accettate allo stesso modo. Se gli adulti ipovedenti si avvalgono del diritto di non sapere, non c’è nulla da discutere. Anche se, così facendo, potrebbero rendere più difficile la diagnosi o il trattamento della loro malattia oculare.
La questione dei test genetici si complica quando entrano in gioco altre persone. Ad esempio, come paziente retinico, se ho figli dovrei sottopormi al test genetico anche se non voglio sapere il risultato? Una risposta valida a questo dilemma spesso angosciante è: Saranno i figli a decidere una volta divenuti maggiorenni.
Cosa fare se il nascituro sarà malato?
Se una persona ipovedente è incinta, la situazione si complica ulteriormente. Potrebbe chiedersi se sia il caso di sottoporre il nascituro a un test genetico, anche se dopo il bambino potrebbe non voler sapere della sua eventuale distrofia retinica. La legge svizzera consente la diagnosi prenatale di malattie gravi, ma i criteri esatti non sono descritti e questo complica ulteriormente le cose.
Supponiamo che una futura madre colpita effettui un test genetico sul suo embrione prima della 21a settimana di gravidanza. Cosa fare se il risultato è, ad esempio, un’amaurosi di Leber congenita? C’è solo una risposta sensata: la questione deve essere chiarita in dettaglio sia dal punto di vista medico che psicologico con degli specialisti in un apposito ospedale svizzero che dispone di un reparto di genetica umana.
Tra i membri di Retina Suisse ce ne sono alcuni che, per loro stessa ammissione, hanno deciso di non avere figli. E questo nonostante non conoscano esattamente i determinanti ereditari. Il loro ragionamento è radicale: ho questa maledetta malattia, quindi non avrò figli. Anche questo atteggiamento è un legittimo diritto.
Rimuovere ogni riflessione per paura
D’altra parte, è possibile prendere una decisione consapevole solo quando si conosce esattamente la patologia oculare. Quando si scopre, tramite un test genetico, di essere affetti da una rara malattia retinica autosomica recessiva, solo allora diventano chiare due cose che non sarebbero emerse senza il test: Se, ad esempio, il rischio di malattia per il nascituro in un caso concreto è uno su diecimila, ciò non è certo statisticamente significativo. Così, una persona pienamente informata può decidere con più consapevolezza di correre un rischio minimo.
I casi eticamente più semplici sono quelli in cui i bambini sono già presenti. Come già detto, i diciottenni possono decidere da soli se vogliono un test genetico – ma cosa succede se sono ancora minorenni? Una situazione tipica è la seguente: Una madre ipovedente non vuole sapere nulla, ma la figlia quattordicenne, anch’essa affetta dalla malattia, vuole conoscere esattamente la sua distrofia retinica. Forse la madre non vuole affrontare la realtà e preferisce ignorare tutto perché ha una eccesiva paura per la figlia?
I reperti casuali possono costituire un ulteriore onere
Oppure ipotizziamo che si tratti di fratelli affetti. Il fratello maggiore rivendica il diritto a non sapere, ma potrebbe contribuire a garantire una prognosi migliore per la sorella minore. Questo nonostante il fatto che la stessa malattia oculare possa avere un decorso diverso tra i fratelli a causa di fattori individuali. Cosa fare, dunque?
I possibili consigli medici in entrambi i casi potrebbero essere: Gli individui hanno 3 miliardi di elementi genetici, e non si tratta di conoscerli tutti, ma solo quell’unico componente eventualmente deteriorato, che causa, ad esempio, un danno alla retina.
Tuttavia, è un dato di fatto che in un test genetico viene analizzato l’intero genoma o l’intero materiale genetico. Perciò si possono scoprire difetti genetici del tutto diversi e inaspettati. Per esempio, una persona ipovedente si sottopone a un test per determinare l’esatta mutazione genetica utile per la sua diagnosi clinica di retinite pigmentosa. E per caso si scopre un’alterazione nell’area del gene BRC1, che causerà il cancro al seno con una certezza quasi del cento per cento.
I test genetici rapidi e le loro sorprese
I medici hanno naturalmente le loro linee guida vincolanti per queste situazioni. Fondamentalmente, le persone con una malattia oculare che desiderano un test genetico devono semplicemente essere consapevoli che è possibile anche la scoperta di una patologia non oftalmologica. D’altra parte, spetta a ognuno di noi decidere quanto si voglia sapere.
Lo stesso vale per gli studi clinici di oftalmologia. I partecipanti possono scegliere di non essere informati nel dettaglio, ma in qualsiasi momento possono richiedere il risultato del test genetico una volta pronti a conoscerlo.
A proposito di risultati casuali, anche le persone non ipovedenti possono avere delle sorprese se vogliono saperne di più sulle loro origini e per semplice curiosità ordinano online un test genetico a basso costo. Ricevono dagli Stati Uniti un kit per il prelievo di campioni di saliva e poche settimane dopo arrivano i risultati, molto più velocemente rispetto ai test effettuati negli ospedali svizzeri. In questo caso possono sorgere delle sorprese: ad esempio, la persona che ha ordinato il test scopre che, in base agli indizi genetici di origine, un genitore o un nonno non può essere stato completamente fedele.
La protezione dei dati rimane una questione delicata
Con questi test genetici selettivi via Internet, si pone il problema della protezione dei dati. Questo perché i laboratori in questione sono imprese commerciali private e amano conservare i loro dati in una rete esterna più ampia a cui sono associate.
Questo è il modello di business di molte aziende di questo tipo: Generano dati genetici grazie ai test, che inseriscono in un enorme database genetico in cambio di denaro. La protezione dei dati è gestita in modo molto diverso e rimane una questione delicata. Gli ospedali pubblici svizzeri, invece, che effettuano ampie analisi genetiche, conservano i dati corrispondenti solo a livello locale e ne garantiscono la protezione.
Ogni persona deve decidere autonomamente come gestire esattamente i propri dati genetici. Quando, nel millennio scorso, i biologi molecolari James Watson e Francis Crick sequenziarono completamente il genoma umano, Watson mise poi il proprio genoma su Internet a scopo dimostrativo. E fino ad oggi può essere visualizzato dal pubblico.
Ma le conseguenze per i suoi discendenti, è bene che rimangano private.